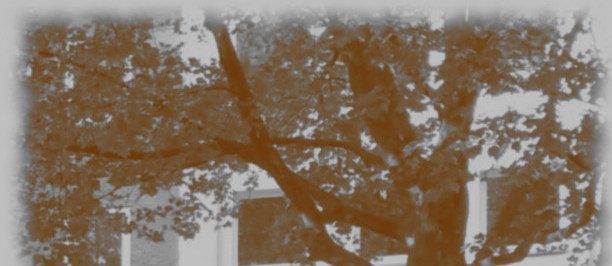Der Tag der Regatta begann mit spiegelnden Goldflüssen, welche die Morgensonne, vom Meerwasser reflektiert, durch die Achterluke in unsere Kajüte sandte. Ich blinzelte ein-, zweimal in diesen vielversprechenden Morgen und schlief dann noch herrliche drei Stunden weiter. Das Frühstück nahmen wir dann bei eben dieser Frühsommersonne im Cockpit zu uns wie fast alle anderen Crews im Hafen auch. Lärm kam allein von den Schwärmen von Austernfischern und anderen Limikolen, die sich mit schrillen Rufen über die Qualität der frühen Wattwürmer zu streiten schienen, nach denen sie eifrig stocherten.
Der offizielle Teil der Regatta begann dann zur Mittagszeit mit der Steuermann-Besprechung am Spiekerooger Segelclub. Dutzende von Crews hatten sich hier eingefunden, um Strecken- und Startmodalitäten in Erfahrung zu bringen. Wir zählten zur vierten von insgesamt fünf Startgruppen. Ein blaues Band am Achterstag würde unsere Gruppe kenntlich machen. Rund 75 Boote würden an diesem Tag an der 61. Seestern-Gedächtnis-Regatta teilnehmen. Sorgfältig prägten wir uns die Regattastrecke ein und zählten uns wechselseitig immer wieder die Namen der Konkurrenz aus unserer Klasse auf. Jeder von uns konnte später ganz genau sagen, welche Boote es galt, achteraus zu lassen. Mittlerweile hatte auch mich das Wettkampffieber gepackt, auch wenn ich sonst wenig von solchen Sportereignissen halte. In dieser Hinsicht, ich gebe es zu, nagt immer noch das Trauma des Schulsports an mir. Wenn man zu denjenigen gehört hatte, die der Lehrer beim Wählen der Mannschaften schlussendlich zuteilen musste, ist die spätere Begeisterung für Wettkämpfe welcher Art auch immer sehr, sehr übersichtlich.

Unser Startfenster war 13.50 Uhr. Christian bestimmte einen Zeitbeauftragten, und die Stoppuhr wurde gespitzt. Schließlich liefen wir zusammen mit all den anderen Booten aus. Das Fahrwasser vor Spiekeroog füllte sich mit mehr und mehr bunten Segeln. Eine Weile lang galt es für uns noch hin und her zu kreuzen, die Uhr fest im Blick, dann kam unser Startsignal. Als der Blitzknall sein Rauchwölkchen an den Himmel zeichnete, waren wir mehr als bereit, und ein Pulk von Booten schoss zeitgleich zur Startlinie – und eines von Steuerbord her quer in die gesamte Gruppe hinein. Ein großer Tumult brach aus ob dieser rowdiehaften Wildsegelei. Gebrüll, hektische Wenden, noch mehr Gebrüll. Ich verlor den Überblick in all dem Chaos. Jemand hätte das Startschiff gerammt, hieß es. Ich verdrehte mir den Hals danach, konnte aber nichts erkennen. Es dauerte eine Weile, bis ich begriff, dass wir mittlerweile und trotz allem längst auf der Wettkampfstrecke unterwegs waren. Christian, wie immer einen kühlen Kopf bewahrend, hatte uns sicher ins Rennen geschickt, und unsere erste Regatta konnte beginnen.
‚Meine erste Regatta‘, beim Abendessen in Aachen, als ich mir die Sache das erste Mal richtig durch den Kopf gehen ließ, klang das noch verdächtig nach, ‚mein kleines Pony‘. Sicher, bereits zu diesem frühen Zeitpunkt war mir klar, dass das sicher alles andere als ein rosaroter Kleinmädchentraum werden würde. Und ein wenig hatte ich unseren Skipper schon im Vorwege bedauert, war ich mir doch sicher, dass eine gute Platzierung, auf die er bestimmt spekulierte, mit uns als Mannschaft – nun, sagen wir es nett – herausfordernd werden würde. Und nun waren wir schon mittendrin.
Am Vormittag hatten die Nachbarcrews alles Mögliche von ihren Booten auf den Steg geschafft, um das Gewicht ihrer Schiffe für die Regatta zu optimieren. Diverse Bierkästen und Spirituosenflaschen vom Vorabend tauchten dort auf, und wir witzelten später darüber, ob wir nicht doch besser noch den Anker von unserem segelnden Wohnwagen abmontieren und zu Pütt un Pann auf den Steg legen sollten. Doch war unsere „Helgoland Express“ gar nicht auf solcherlei Spielereien angewiesen. Zuverlässig und gewandt segelte sie nun mit uns von Wendeboje zu Wendeboje, sich gut im Feld der Kontrahenten machend.

Die Crew hielt derweil die Augen offen nach der „Grauen Maus“ und dem „Buttpedder“ – der Konkurrenz aus unserer Klasse. Beide erspähten wir schon nach der ersten Wende weit abgeschlagen achteraus. Juhu, wir lagen vorn! Meine Aufmerksamkeit wurde zunehmend vom bunten Treiben um uns herum in Beschlag genommen. Immer wieder schossen kleinere Boote quer, und Christian nutzte gleich zweimal den Luxus einer Fahrtenyacht – das Schiffshorn – um die Crews entsprechend wildsegelnder Boote an ihre Ausweichpflicht zu erinnern. Die einen merkten es schnell, als sie aufgeschreckt unter ihrem Segel hervorlugten. Die anderen gar nicht. ‚Sind halt keine großen Guckis‘, kommentierte unser Skipper die Lage nach erfolgreichem Ausweichmanöver unsererseits.
Insgesamt war ich als völliger Regattaneuling sehr erstaunt, dass uns auf einigen Teilstrecken so viel Zeit blieb, das Geschehen rund ums eigene Boot so genau zu studieren und die Fahrt in der Sonne auch entspannt zu genießen. Ich hatte mir das Ganze wesentlich hektischer vorgestellt. Dass es das durchaus auch sein konnte, erfuhren wir später, als unser Bootsnachbar am Steg stolz verkündete, er hätte nur sechsmal das Segel wechseln müssen auf dieser Strecke. Wir dagegen schafften es ohne Wechsel des Segelkleids und vorheriger Zwangsdiät des Schiffsbauches und freuten uns über herrlichstes Segelwetter. Sonne satt. Der Fahrtwind kühlte auf den Am-Wind-Strecken, raumschots baumten wir die Fock aus, und ich schaute mich an den bunten Spis und Gennakern um uns herum satt. Besonders hübsch anzuschauen waren auch die Teilnehmer des letzten Startfensters – einige Plattbodenschiffe mit den typisch roten Segeln über Vollholzrümpfen. Wieder einmal bedauerte ich zutiefst, dass ich von Papas Tischlerfertigkeiten aber auch so gar nichts geerbte hatte, sonst stünde die Entscheidung für das Traumboot längst fest.

Der schönste Zuschauer der Seestern-Gedächtnis-Regatta auf Spiekeroog: ein Seehund, der sein Köpfchen neugierig aus dem Wasser reckte und das lustige Treiben der schnellen Boote mit den bunten Segeln zu begutachten schien. Hätte er gekonnt, ich bin mir sicher, er hätte sicher sein Köpfchen darüber geschüttelt. Wozu die Eile? Es ist doch Wasser genug für alle da…
Zwei Runden waren zu absolvieren: von der Startlinie aus nach Süden gen Neuharlingersiel, eine Wende zurück nach Norden gen Spiekeroog, eine Wende und westwärts gen Langeoog und zurück zum Startschiff für die nächste Runde. Es gab so viel zu sehen, dass die Zeit wie im Flug verging. Sylke stand am Ruder und manövrierte uns sicher durch das Geschehen. Eine der besten Gelegenheiten, diverse Ausweichregeln zu repetieren. Als besonderes Schmankerl navigierte auch noch die Fähre zwischen Insel und Festland durch das dichte Feld der Segelboote oder besser, dies um besagte Fähre drum herum.
Und dann wurde es spannend: die Ziellinie kam in Sicht, die Startnummer wurde an Deck geholt und gleich – da drängte uns doch glatt das grüne Boot, das uns schon einige Male während der Regatta frech nahegekommen war, auf den letzten Metern ab, schob sich vor uns und durchs Ziel. Gute Seemannschaft geht anders! ‚Hey, hallo!‘ das war der Moment für echte Entrüstung, aber Christian riet zur Ruhe. Und ja eigentlich war es auch egal, denn sie segelten nicht in unserer Klasse, und von Mäusen und Plattfischpiekern hatten wir schon seit gefühlten Stunden nichts mehr gesehen. Also Startnummer hochgerissen und rein ins Ziel. Das war’s. Juhu! Gefühlt hatten wir auf alle Fälle schon mal gewonnen.
Ich löste Sylke am Ruder ab, nun ging es nach Hause in den Hafen – zusammen mit allen anderen. Wir drehten eine Orientierungsrunde durchs Hafenbecken. Ja, der Liegeplatz war noch frei – gleich neben den Bierkästen und dem anderen Krams vom Nachbarboot. Also Segel bergen, Motor an und rein in die gute Stube. So ging ein weiterer herrlicher Segeltag langsam zu Ende.
Auf dem Plan stand nun als nächstes das wohlverdiente Abendessen: Kartoffelgratin, Grillkäse, Salat und für die Nichtvegetarier ein Hühnerbein. Das Ankerbier wurde an diesem Abend um ein wohlverdientes zweites ergänzt. Satt und zufrieden harrten wir der Siegerehrung, die im Segelclub am selben Abend noch stattfinden sollte. Das Ereignis war für 21 Uhr angesetzt. So wogen wir uns schon vor Beginn in der Gewissheit, dass dies nur ein kurzes Gastspiel unsererseits auf dem Regattaball werden würde, denn für den nächsten Tag stand die Heimreise und damit das Auslaufen mit dem Morgenhochwasser schon fest. Das hieß, um fünf Uhr würden wir wieder losmachen müssen. Also wie viele Stunden Schlaf? Es gibt Momente im Leben, da rechnet man lieber nicht so genau… Egal, bis dahin war es ja noch etwas Zeit. Grund genug, ein wenig stolz zu sein, hatten wir allemal. Immerhin waren wir keine jahrelang eingespielte Crew, sondern gerade mal drei Tage zusammen auf dem Wasser unterwegs, und unsere „Helgoland Express“ war sowieso eine Kuriosität für sich im flachen Wattfahrwasser. Also: freuen – jetzt!
‚Das war Können!‘ schallte ein bereits deutlich angetrunkener Ruf aus den hinteren Reihen, als die Regattaleitung kritisch das Tohuwabohu ansprach, das unsere Startsequenz so durcheinander gewirbelt hatte. Die Preisrichter hoben ob dieser Uneinsichtigkeit missbilligend die Augenbrauen. Allgemeines Kopfschütteln. Dann ging es endlich an die Preisverleihung.

Für uns gab es dann noch eine unerwartete Überraschung, wies doch unsere Bootsklasse plötzlich zwei weitere Mitstreiter auf, die bei der Steuermann-Besprechung noch nicht auf dem Plan gestanden hatten. Und auch wenn wir deutlich schneller als Mäuse und Plattfischpiecker gewesen waren, hatte man uns zu guter Letzt in Gemeinschaftsarbeit doch noch überholt. Der Skipper der „Teamwork“ strahlte ins Publikum, und Christian kehrte etwas irritiert mit Silberschiffchen und der aus dem Geschenkeboot geangelten Dose Isolierspray an unseren Tisch zurück. Wir witzelten darüber, wer letztere wohl als erstes auf seinem Kaminsims würde drapieren dürfen, fotografierten eifrig unser Schiffchen, reichten es von Hand zu Hand und freuten uns über unsere Platzierung. Als die Regattaleitung schließlich die Tanzfläche freigab und wie aufs Stichwort die Liedzeile „Verstand über Herz“ erklang, nahmen wir selbige wörtlich, machten uns auf den Weg zurück zum Boot und zu einer viel zu kurzen Nacht.